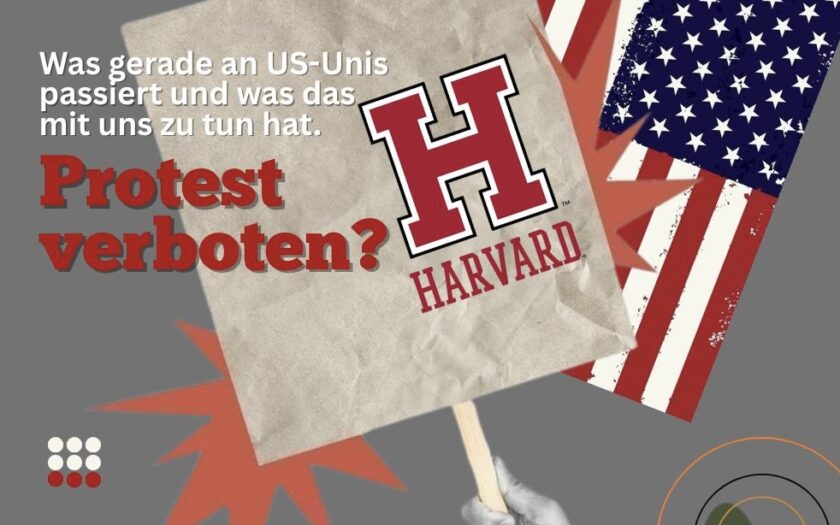Universitäten waren früher Orte des Widerstands. In den USA spielten sie eine riesige Rolle im Kampf gegen den Vietnamkrieg oder für mehr Bürgerrechte. Heute? Sie wirken erschreckend still – und das hat Gründe, die uns auch hier in Europa zu denken geben sollten.
In den USA stehen viele Unis – allen voran Harvard – unter massivem politischen Druck. Der Vorwurf: Sie würden antisemitische Proteste dulden, weil Studierende gegen den Krieg in Gaza demonstrieren. Die Reaktion: Fördergelder gestrichen, Visa für ausländische Studis gestoppt, Unileitungen unter Druck gesetzt, Studierende verhaftet. Mehr als 3000 Festnahmen gab es bisher.

Das alles passiert in einem Klima, das Kritiker*innen als “Angstkultur” beschreiben. Viele Lehrkräfte sagen: Wir halten lieber den Mund, sonst riskieren wir unseren Job. Auch viele Studierende halten sich zurück – aus Angst vor Repression, Rausschmiss oder öffentlicher Hetze.
Doch das wirklich Krasse: Viele dieser Maßnahmen wurden durchgesetzt, ohne dass Unis oder Studierende mitreden konnten. Regeln wurden einfach verordnet – ohne Gremien, ohne Mitsprache.
Und hier kommt die Frage, die uns betrifft: Könnte so etwas auch bei uns passieren?
Klar, wir leben in einem demokratischen Rechtsstaat. Aber auch hier erleben wir immer wieder, dass Entscheidungen über Köpfe hinweg getroffen werden – in der Bildungspolitik, beim Klima oder bei Digitalisierungsthemen. Wie viel Mitspracherecht haben Schüler*innen, Azubis oder Studierende eigentlich wirklich?
Und vor allem: Sind wir überhaupt noch bereit zu protestieren?
Fridays for Future hat gezeigt, dass junge Menschen etwas bewegen können. Aber wie lange ist das her? Und wie sieht es heute aus? Wären wir bereit, für unsere Werte auf die Straße zu gehen – oder sind wir längst zu beschäftigt, zu müde oder zu desillusioniert?
Was in den USA passiert, ist ein Weckruf. Nicht nur für Unis – sondern für uns alle.